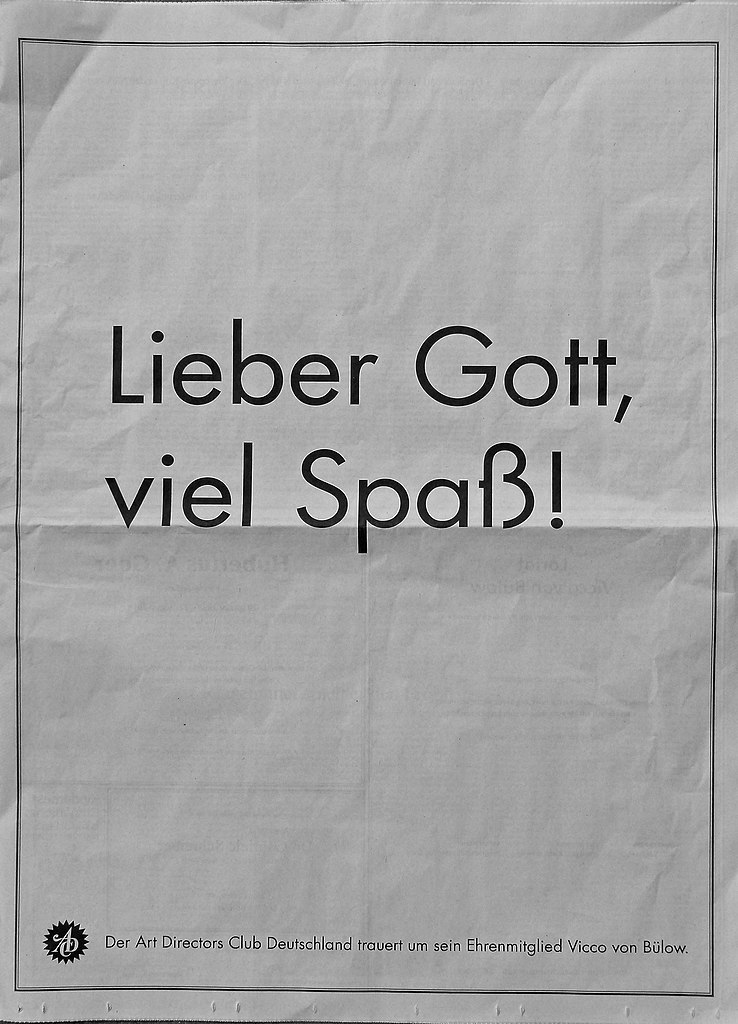Viele
Verantwortliche „in
Kirche“ gehen heutzutage
den
Weg des geringsten Widerstandes, wenn
es um die Verkündigung des Glaubens und der Moral geht; den Weg,
der
jede Anstößigkeit vermeidet:
Man
ist, insbesondere
dort, wo man sich durchaus auch als „Dienstleister“ sieht,
bemüht, „anschlussfähig
an die Erfahrung der Menschen“ zu sein,
„jedem etwas zu
bieten“ und „alle mitzunehmen“.
In
kurz: Man möchte gerne die Volkskirche (oder einen Anschein davon)
aufrecht erhalten.
Dieses
vorgehen geschieht
nicht selten in guter Absicht, und man will es auch
im Evangelium begründet sehen: Sollen
wir denn
nicht allen
Menschen Jesus verkünden?
Müssen wir es denn
nicht allen
Menschen ermöglichen, das Evangelium anzunehmen?
Ja,
diese Möglichkeit sollen wir allen ohne Ausnahme eröffnen.
Aber was heißt das?
Wir
sollen Jesus
allen Menschen verkünden, das ist richtig: „Geht hinaus in die
ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“
(Mk
16,15; vgl. Kol
1,23) Alle
Menschen sollen Gottes
Heil schauen (vgl. Lk 3,6; vgl.
Offb 3,15).
Aber: Nirgends
im Evangelium steht, dass alle,
denen es verkündet wird und die es sehen, es auch annehmen
werden. Es
besteht ein gewaltiger
Unterschied, ob wir allen Menschen die Möglichkeit
geben, das Evangelium anzunehmen (indem
wir es verkünden),
oder ob wir das Evangelium allen Menschen annehmbar
machen
(indem
wir es verwässern).
Eines
der bekanntesten Gleichnisse Jesu ist
das Sämannsgleichnis:
„Siehe,
ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf
den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel
auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf,
weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde
die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder
ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und
erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und
brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils
dreißigfach.“ (Mt
13,3-8)
Es
ist bezeichnend, dass gerade dieses Gleichnis in aller
Ausführlichkeit von Jesus selbst erläutert wird, so
dass kein Zweifel über seine Bedeutung besteht:
Der
Same ist das Wort der Verkündigung,
das längst nicht überall, wo es ausgestreut (verkündet) wird,
Frucht zu bringen vermag. Also: Was
Jesus verkündet fällt
nicht überall auf fruchtbaren Boden, es scheint sogar eher nur der
kleinere Teil zu sein, der
letztlich
Frucht bringt,
meistens trifft es auf taube Ohren. Für
uns Heutige
ist
das
schwer
vorstellbar: Wir
glauben gern, dass doch jeder halbwegs vernünftige Mensch Jesus toll
finden müsste. Seine Botschaft – meinen
wir damit eigentlich auch seinen ständigen Ruf zur radikalen Umkehr,
oder doch eher ausschließlich den zur dienstbereiten
Mitmenschlichkeit? –
müsste doch von jedem anerkannt und bejaht werden können…
Aber
genau das war offenkundig nicht der Fall, die
Menschen nahmen ihn nicht auf (vgl.
Joh 1,11),
lehnten ihn ab, nahmen
Anstoß,
hassten und verfolgten ihn sogar bis
zum Tod.
Dabei
ist es zu billig, hier einfach die „bösen“ Menschen zu
beschuldigen. Es
sind ganz normale Menschen, die an ihm wegen seines Anspruchs Anstoß
nehmen (vgl. Mt 13,57), und sogar seinen eigenen Jüngern prophezeite
er mit
Blick auf sein Leiden:
„Ihr
werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen“ (26,31). Jesu
Worte und
Taten
kommen nicht bei jedem noch so wohlwollenden Hörer an; bei
den meisten Zuhörern stieß Jesus früher oder später auf
Ablehnung, am Kreuz, am Ziel und Höhepunkt seines Heilsweges, war er
dann fast ganz allein.
Für
uns stellt sich die Frage: Warum
sollten wir Heutigen mehr Erfolg in der Verkündigung erwarten, als
es Jesus selbst beschieden war? Sind wir bessere Verkünder als er?
Sind
wir bessere Zeugen
der Liebe Gottes, als die Liebe Gottes in Person?
Wenn
es nicht aufgeht, ist laut
Gleichnis
nicht das Saatgut
(d.i.
die Botschaft)
schuld, sondern der unfruchtbare
Boden (oder
die Doofheit des Sämanns, weil er das Saatgut auf die Felsen
wirft…).
Die
Bibel ernst nehmend,
müssen wir realistischerweise
anerkennen,
dass es auch „Säue“ gibt, vor die wir die „Perlen des
Heiligen“ nicht werfen sollen, damit sie nicht
zertreten werden
(vgl. Mt 7,6), dass es nicht selten vorkommt, dass Jesu Jünger aus
einer Stadt abziehen müssen
und von
ihren Sandalen den
Staub „zum Zeugnis gegen sie“ abschütteln (vgl. Lk 9.5), und
dass selbst „viele seiner Jünger“ sich wegen
der „harten Worte“ Jesu
zurückziehen und „nicht
mehr mit ihm
umhergehen“ (Joh 6,66). Insbesondere
in
letzterem Fall,
in
der großen Eucharistierede im Johannesevangelium, offenbart
Jesus in unübertrefflicher Deutlichkeit seinen Zuhörern
etwas,
was sie erschüttern
musste:
„Wer
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich
werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag“
(Joh
6,54)
Ergebnis:
„Viele
seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten: Diese Rede ist hart. Wer
kann sie hören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten,
und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? [...] Daraufhin zogen sich
viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher.“
(VV.
60-61.66)
Jesus
ging ihnen nicht nach und
rief:
„Halt, wartet, ich habe
es
nicht so gemeint, ich meinte es doch bloß symbolisch!“,
sondern
er
blieb beim verstörenden
Realismus seiner Aussage und fragte seine Apostel: „Wollt
auch ihr weggehen?“ (V. 67)
Dieser
Weggang von
„vielen“ seiner Jünger
wird umso erschütternder, wenn man bedenkt, was die Konsequenz für
die Weggehenden sein könnte: „Wenn
ihr das Fleisch
des Menschensohnes nicht
esst und sein Blut nicht
trinkt, habt ihr das Leben nicht
in euch.“
(Joh
6,53) Der
Clou: Jesus
hat das
„Brot vom Himmel“
seinen Zuhörern von einst durchaus
pädagogisch klug
anhand ihrer eigenen Lebens-
und
Gedankenwelt zu erklären versucht, nämlich
ausgehend von einem
Vergleich
mit dem Manna
in der Wüste (Joh
6,48-51)
– und trotzdem kehrten sich viele
ab und akzeptierten
es
nicht. Pädagogische
Klugheit scheint also auch nicht das Allheilmittel zu sein.
Den
Fall von Johannes 6
würde man in der heutigen Pastoral
als
unerhörten
Skandal sehen: Jesus geht seinen
Zuhörern
nicht nach, er lässt sie ziehen
und bleibt bei seinem Wort, das
nicht bei jedem Anklang fand.
Wir
lernen: Noch
nie war das
Evangelium
zeitgemäß, den
Zuhörern angemessen, allgemein
verständlich oder mehrheitsfähig.
Die
Realität ist, dass Jesus
für die Verkündigung des Evangeliums
v.a.
Ablehnung erfuhr und letztlich auch
verfolgt wurde,
ebenso die Apostel. Manchmal
wird versucht, den Grund für diese Verfolgung ausschließlich in
politischen Motiven zu suchen, nicht in der verkündeten Botschaft.
Aber das ist Unsinn: „Wir
haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben,
weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.“ (Joh 19,7)
Hier
kann
der Prophet Ezechiel ein stimmiges Vorbild für
uns
sein:
Gott sendet ihn zum Volk Israel, bekräftigt aber eigens, dass er
sich nicht um den Erfolg oder Misserfolg seiner Predigt kümmern
soll: „Zu
ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott, der
Herr. Sie aber: Mögen sie hören oder lassen – denn sie sind ein
Haus der Widerspenstigkeit –, sie werden erkennen müssen, dass
mitten unter ihnen ein Prophet war.“ (Ez 2,4-5; vgl. V.
7; 3,11) Der Auftrag der Kirche, wie der der Propheten und Jesu
selbst und
seiner Apostel,
war
und ist
es nicht, „gut anzukommen“, sondern das Wort zu säen. Jesus
sagte doch:
„Wenn man euch nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will,
geht weg aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den Staub
von euren Füßen!“ (Mt 10,14) Er sagte
nicht, was
man heute zu gerne denkt:
„Wenn
man euch nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, dann
sagt
ihnen andere Worte,
sie hören wollen!“
Ob das
Wort
auf guten Boden fällt, wächst und Frucht bringt, haben wir nicht in
der Hand, wir können höchstens für die Qualität des Samens
sorgen, also
um die Authentizität und Integrität des verkündeten Evangeliums.
Das Wachsenlassen ist Gottes Sache (vgl. 1Kor 3,5-9). Aus dieser
Demut – in dem Wissen, dass wir die zu verkündigende Botschaft nie
allen annehmbar
machen können – erwächst dann
womöglich ganz
von selbst ein Selbstbewusstsein, das der gesellschaftlichen
Realität
die Stirn bietet und trotzdem
verkündet, wie
Ezechiel (vgl. Ez 3,7-9).
Damit
ist nicht jedem gedankenlosen Verkündigungsirrsinn (z.B. Obstkiste
in der Fußgängerzone) Tür und Tor geöffnet, denn natürlich gilt
es, auf Identität, Situation und Fassungsvermögen der Zuhörer
Rücksicht zu nehmen. Paulus ist das beste Beispiel, wenn er an die
Korinther schreibt: „Vor euch, Brüder und Schwestern, konnte ich
aber nicht wie vor Geisterfüllten reden; ihr wart noch irdisch
eingestellt, unmündige Kinder in Christus. Milch gab ich euch zu
trinken statt fester Speise; denn diese konntet ihr noch nicht
vertragen. (1Kor 3,1-2) Der springende Punkt ist aber gerade der,
dass dieser
Status
überwunden werden soll. Der
gleiche Paulus schreibt nämlich auch, er „bete darum, dass eure
Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr
beurteilen könnt, worauf es ankommt.“ (Phil 1,9) Und noch
deutlicher:
„Daher
hören wir […] nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass
ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und
geistlichen Einsicht erfüllt werdet. Denn ihr sollt ein Leben
führen, das des Herrn würdig ist und in allem sein Gefallen findet.
Ihr sollt Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in
der Erkenntnis Gottes. […] Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle
in [seinem Sohn] wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen.
Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen“ (Kol
1,9-10.19-20).
Abstriche
an Glaubensinhalten und an
der
Moral
zu machen, ist ein Symptom einer absterbenden
Volkskirche.
Nur jemand, der selbst aus der Volkskirche stammt, könnte auf die Idee kommen, den Glauben nach eigenem Ermessen umzumodeln (oder jemand, der das ohnehin vorhat und extra dafür der Körperschaft öffentlichen Rechts "Katholische Kirche in Deutschland" beitritt… auch solche gibt es). Die
Akteure der Glaubenszersetzung, auch
die Theologen,
kommen allesamt aus der Volkskirche: Viele
Bischöfe
die von der
„Relevanz der
Kirche in der Gesellschaft“
reden, trauern dem Ansehen nach, das ihr Amt in Zeiten der Volkskirche
genossen hat, manch
andere Funktionäre sehnen sich nicht minder nach den Pfründen, die
ihre Position früher einmal mit sich brachte
und
die Theologenschaft möchte einfach möglichst vielen was zu sagen
haben, sie brauchen ein Publikum (darum reden sie über alles
mögliche, nur nicht über den Glauben).
Diese
Zersetzung ist
1.
der Versuch, die Flächendeckung der Volkskirche möglichst zu
erhalten, was logischerweise nur dadurch bewerkstelligt werden kann,
dass man Glaube und Kirche einer möglichst großen Zahl von Menschen
zumutbar, annehmbar, bekömmlich macht. Sprich: indem man Glaube und
Moral den Wünschen der Menschen anpasst. Im Idealfall lässt man
„demokratisch“ (d.h. durch handverlesene Repräsentanten) darüber
abstimmen.
2.
eine Reaktion auf (auch zu Recht) beklemmend empfundene Eigenheiten des
Volkskirchentums, deren man sich entledigen will. Weil die
Volkskirche (die man aber, siehe 1., komischerweise zu erhalten
versucht) problematische Begleiterscheinungen hatte, muss man alles
mögliche ändern, von dem man meint, dass es für die Probleme
verantwortlich war. Dafür eignen sich besonders all die Dinge, zu
denen man selbst eh keinen echten Bezug hat.
Der Form wird so Priorität vor den Inhalten gegeben. Was
den Handelnden nicht in den Sinn kommt ist, dass die Probleme der
Volkskirche in ihrer Sozialform (eben: Volkskirche) begründet sind,
nicht in Glaube und Moral, denn ihr Festhalten an jener Form bei
gleichzeitiger Ablehnung dieser Inhalte übertönt alles. Umso bedenklicher,
dass es im Grunde diese Sozialform ist, die man erhalten möchte,
indem man den Glauben abspeckt. Wie man es auch dreht und wendet, das
Vorgehen ist in jeder Hinsicht ganz falsch.
Der
natürliche Zustand des Christen ist nicht die Volkskirche, sondern
die Verfolgung. Jesu Verheißung lautete bekanntlich nicht:
„Selig seid ihr, wenn alle um euch herum nominell Christen sind…“
sondern: „Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und
alles Böse über euch redet um meinetwillen. […] wer aber das
Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.“ (Mt 5,11; 10,39)
Freilich: Wir sollen die Verfolgung nicht suchen oder provozieren.
Paulus: „Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen
Frieden!“ (Röm 12,18) Aber dieses „soweit möglich“ betrifft
genau die Lehre des Glaubens und das aus ihr resultierende moralische
Leben, das zu bezeugen Standhaftigkeit gegen Widerstände verlangt:
„Seid
also standhaft, Brüder und Schwestern, und haltet an den
Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben“ (2Thess
2,15).